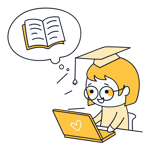ETF-Blase: Was dran ist – und was ihr daraus macht
Immer wieder hört man von Kritiker:innen, dass ETFs eine systemische Gefahr darstellen. Manche sprechen sogar von einer „ETF-Blase“ – und ziehen Vergleiche zur Immobilien- und Finanzkrise von 2008. Was ist dran an diesen Vorwürfen?
In diesem Artikel gehen wir diesen Vorwürfen auf den Grund. Wir prüfen, welche Sorgen berechtigt sind, wo die tatsächlichen Risiken liegen und wie ihr euch dagegen sicher aufstellt.
Der Begriff „ETF-Blase“ ist irreführend, denn er vermischt zwei völlig verschiedene Dinge: die Sorge, dass Aktien zu teuer sind (Marktblase), und die falsche Annahme, dass ETFs selbst die Kurse künstlich aufblähen.
Ein Welt-ETF ist nur ein Spiegel des Marktes, kein Motor: Er bildet die Kurse nur ab, anstatt sie selbst zu machen. Die eigentlichen Preise werden von Millionen von Anleger:innen weltweit gemacht.
Die echten Risiken für euch sind nicht die ETFs selbst, sondern zu hohe Konzentrationen im Depot (z. B. zu viel Geld in wenigen US-Tech-Aktien) oder panische Verkäufe in einem Crash-Szenario.
Dagegen schützt ihr euch am besten mit einem breit gestreuten Welt-ETF, einem disziplinierten Sparplan und einem Notgroschen für Notfälle.
Was meinen Kritiker:innen mit „ETF-Blase“?
Wenn ihr in den Finanznachrichten oder auf Social Media von einer „ETF-Blase“ lest, ist es wichtig zu wissen: Meistens werden hier zwei völlig verschiedene Sorgen in einen Topf geworfen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben.
Auf der einen Seite steht die Sorge, dass Aktien allgemein viel zu teuer sein könnten. Auf der anderen Seite steht der Vorwurf, dass ETFs als Anlageprodukt selbst ein Problem sind und die Kurse künstlich aufblähen.
Um das klar zu trennen, haben wir die beiden Vorwürfe für euch in einer einfachen Übersicht aufgedröselt:
Sorge 1: Die Markt-Blase (Das „Was“)
Hier geht es um den Inhalt eures ETFs: die Aktien selbst. Die Sorge ist, dass die Kurse von Unternehmen wie Apple oder Nvidia so stark gestiegen sind, dass sie überbewertet sind. Dabei ist ganz egal, ob ihr sie als Einzelaktie, über einen klassischen Fonds oder per ETF kauft. Wenn diese Blase platzt, fallen die Aktienkurse, und das trifft alle Anleger:innen gleichermaßen.
Wichtig: Platzt eine Preisblase (z. B. Weltfinanzkrise 2008), trifft euch das alle gleichermaßen – egal, ob ihr über Einzelaktien, aktive Fonds oder ETFs investiert seid. Gegen solche Marktblasen könnt ihr euch nur bedingt durch eine breite Streuung schützen – sie sind ein allgemeines Risiko an der Börse.
Sorge 2: Die ETF-Blase (Das „Wie“)
Hier geht es um das Werkzeug, mit dem ihr investiert: den ETF. Der Vorwurf lautet, dass ETFs durch ihre Funktionsweise die Kurse automatisch nach oben treiben, weil dadurch viel Geld „blind“ in dieselben großen Aktien fließt. Das wäre dann ein ETF-spezifisches Problem, das nur durch die Beliebtheit von Indexfonds entsteht.
Um dies gleich vorwegzunehmen: Die Sorge ist unbegründet. Denn wie oben schon kurz erwähnt, sind ETFs nur der Spiegel des Marktes und nicht sein Motor.
Ein ETF (Exchange Traded Fund) ist ein Investmentfonds, der an der Börse gehandelt wird und die Entwicklung eines bestimmten Index nachbildet. Bildlich gesprochen ist er wie ein Korb voller Aktien, der automatisch festen und transparenten Regeln folgt.
Die Indexgewichtung erfolgt in der Regel nach Marktkapitalisierung. Das bedeutet: Je größer und wertvoller ein Unternehmen an der Börse ist, desto stärker ist es auch im ETF vertreten. Der ETF „denkt“ dabei nicht selbst, sondern folgt strikt den vordefinierten Regeln des Index und bildet so dessen Entwicklung möglichst exakt nach.
Für den Rest dieses Artikels konzentrieren wir uns auf die Vorwürfe, die sich direkt gegen die Funktionsweise und die Struktur von ETFs richten. Also auf die Frage, ob sie die Finanzmärkte an sich gefährlicher machen.
Woher kommt die Kritik?
Die Sorge vor einer „ETF-Blase“ ist kein reines Internet-Phänomen. Die Kritik kommt aus verschiedenen, teils sehr prominenten Ecken der Finanzwelt. Bevor wir die einzelnen Vorwürfe prüfen, ist es wichtig für euch zu verstehen, wer diese Kritiker:innen sind und welche Interessen oder Sorgen sie antreiben. Grundsätzlich lässt sich die Kritik auf drei Hauptgruppen zurückführen.
Aktive Fondsmanager:innen und Vermögensverwalter:innen
Dies ist die lauteste und größte Gruppe von Kritiker:innen. Viele große, traditionelle Fondsgesellschaften, die teurere, aktiv gemanagte Fonds verkaufen, haben in der Vergangenheit vor den Risiken des passiven Investierens gewarnt. Der Kernvorwurf lautet zusammengefasst in etwa so:
ETFs seien „dummes Geld“, das blind den Markt kauft, ohne auf die Qualität einzelner Unternehmen zu achten. Das führe zu Ineffizienzen und Blasenbildung bei großen Index-Schwergewichten.
Eines der drastischsten Beispiele stammt von der Investmentfirma Alliance Capital (ehemals: Sanford C. Bernstein). In einem viel beachteten Bericht aus dem Jahr 2016 bezeichneten ihre Analysten passives Investieren als „schlimmer als Marxismus“, weil es die freie Preisbildung am Markt untergrabe.
Auch andere Branchengrößen wie Fidelity oder T. Rowe Price betonen, dass ETFs nicht zwischen „guten“ und „schlechten“ Unternehmen unterscheiden könnten und aktive Manager:innen in Krisenzeiten überlegen seien.
Falls ihr euch tiefer mit den Argumenten aktiver Fondsmanager:innen auseinandersetzen wollt, haben wir hier ein Whitepaper von T. Rowe Price und ein Interview mit Abigail Johnson, CEO von Fidelity.
Hier liegt ein klarer Interessenkonflikt vor. Das Geschäftsmodell aktiver Fondsmanager:innen steht durch den Siegeszug der günstigen und transparenten ETFs massiv unter Druck. Natürlich besteht hier ein gewisses Interesse, die Nachteile der Konkurrenz zu betonen.
Dass aktive Fondsmanager:innen es nur selten schaffen, den Markt zu schlagen, hat der Ökonom Burton Malkiel in seinem Bestseller „A Random Walk Down Wall Street“ eindrucksvoll gezeigt. Seine berühmte Metapher: Ein Affe, der mit verbundenen Augen Dartpfeile auf eine Aktienliste wirft, könne ein Portfolio zusammenstellen, das genauso gut abschneidet wie das eines Experten.
Das Wall Street Journal machte später den Test und ließ seine Redakteur:innen Dartpfeile werfen. Das Ergebnis war verblüffend: Das zufällige Portfolio schlug das der aktiven Händler um 22 % – und nur ein Drittel der „Profis“ lag über dem S&P 500.
Die Pointe für euch als Anleger:innen ist einfach: Es ist in der Regel klüger, nicht auf irgendwelche Tipps von Expert:innen zu wetten, sondern einfach in den gesamten Markt zu investieren – am einfachsten geht das mit einem breit gestreuten Welt-ETF.
Berühmte Investor:innen und „Crash-Propheten“
Neben den Fondsgesellschaften gibt es auch einige bekannte Investor:innen, die sich öffentlich Sorgen um die Stabilität des ETF-Marktes machen. Ihre Warnungen finden besondere Beachtung, weil viele von ihnen in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie Marktrisiken früh erkennen können.
Ein prominentes Beispiel ist Michael Burry, der durch den Film „The Big Short“ bekannt wurde, nachdem er die Finanzkrise von 2008 korrekt vorhergesagt hatte. Burry zählt zu den schärfsten Kritiker:innen von Indexfonds. Er vergleicht den massiven Geldstrom in passive ETFs mit den komplexen, verbrieften Hypothekenkrediten, die einst die Finanzkrise auslösten. Sein Hauptvorwurf lautet:
Weil alle „blind“ dasselbe kaufen, findet keine echte Preisfindung mehr statt. In einer Krise könnten dann alle gleichzeitig aus einem sehr engen Ausgang stürmen wollen, was zu einem Crash führen würde.
Diese Kritik ist ernst zu nehmen, da sie von einem nachweislich scharfsinnigen Investor kommt. Sie zielt direkt auf die Struktur von ETFs und die Psychologie der Anleger:innen ab.
Dennoch spricht wenig dafür, dass ETFs per se ein systemisches Risiko darstellen. Die zugrunde liegenden Aktien werden weiterhin an den Börsen gehandelt, und ihre Preise ergeben sich aus Angebot und Nachfrage – also realen Marktmechanismen.
Auch wenn es in Krisenzeiten zu starken Kursrückgängen kommen kann, gilt gerade dann der Grundsatz: Ruhe bewahren und langfristig denken. Wer diesem Buy-and-Hold-Prinzip treu bleibt, profitiert davon, dass sich die Märkte historisch gesehen nach jedem Crash wieder erholt haben.
Finanzaufseher:innen und Institutionen
Die dritte Gruppe von Kritiker:innen hat keine eigenen Geschäftsinteressen, sondern beobachtet den Markt aus einer systemischen Perspektive. Dazu zählen vor allem offizielle Institutionen und Aufsichtsbehörden, deren Aufgabe es ist, die Stabilität des Finanzsystems zu sichern.
Das bekannteste Beispiel sind Institutionen wie die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), oft als die „Bank der Zentralbanken“ bezeichnet. In ihren Berichten hat sie auf mögliche Risiken hingewiesen, die mit der zunehmenden Bedeutung von ETFs verbunden sein könnten.
Dabei geht es weniger um die Gefahr einer spekulativen Blase, sondern um die Frage, ob die wachsende Größe von ETFs die Finanzmärkte in Stresssituationen anfälliger machen könnte. Die zentralen Bedenken lauten in etwa so:
Was passiert, wenn in einem Crash extrem viele ETF-Anteile auf einmal verkauft werden? Bleibt der Handel liquide und fair?
Diese Kritik ist nicht panisch, sondern analytisch. Sie zeigt, dass sich auch die wichtigsten Finanzinstitutionen der Welt mit der Funktionsweise von ETFs beschäftigen, um systemische Risiken frühzeitig zu erkennen. Solche Analysen sollen keine Panik schüren, sondern Risiken besser verstehen helfen – insbesondere in extremen Marktsituationen.
Wie groß ist der Einfluss von ETFs wirklich? Ein Blick auf die Zahlen
Fasst man die Bedenken aller drei Kritikergruppen zusammen, laufen sie auf eine zentrale Sorge hinaus: ETFs seien inzwischen zu groß, zu mächtig und hätten einen zu starken Einfluss auf die Finanzmärkte – sowohl in normalen Zeiten als auch in Krisen. Doch wie groß ist dieser Einfluss wirklich?
Daten von Analysehäusern wie Morningstar und ETFGI LLP zeigen: Trotz des anhaltenden Booms bleibt der Anteil von ETFs am weltweiten Markt überschaubar. Selbst innerhalb des Aktienmarkts machen ETFs nur einen kleinen Teil des Gesamtvolumens aus.
ETF-Vermögen weltweit: 14,85 Bio. USD (Ende 2024)
Weltweiter Aktienmarkt: rund 114,5 Bio. USD Marktkapitalisierung (2023)
US-Handelsvolumen: ETFs stellen etwa 30 % des gesamten Aktienhandels
Passiv vs. aktiv (USA): Passive Fonds überholen aktive 2023 erstmals (52 % vs. 48 %)
Gesamtmarkt inkl. Derivate: rund 1.088 Bio. USD – ETF-Anteil unter 1,5 %
Der weltweite Aktienmarkt stellt nur rund 10,5 % des gesamten Finanzmarkts dar. Innerhalb dieses Aktienmarkts entfallen etwa 13 % auf ETFs. Bezogen auf den gesamten Finanzmarkt – also inklusive Anleihen, Derivate und anderer Anlageklassen – entspricht das einem Anteil von nur rund 1,5 %.
Wie klein der ETF-Markt im Gesamtbild tatsächlich ist, zeigt die folgende Grafik:

ETFs machen nur rund 13 % des weltweiten Aktienmarkts aus – und dieser wiederum nur etwa 10,5 % des gesamten Finanzmarkts. Insgesamt liegt der ETF-Anteil damit bei unter 1,5 % des globalen Finanzvermögens.
Der tatsächliche Einfluss von ETFs wird überschätzt: Der Markt für ETFs wächst, keine Frage, aber im Kontext der gesamten Kapitalmärkte – Einzelaktien, aktive Fonds, Pensionskassen, Private Equity, Derivate – bleiben ETF-Investments weiterhin eine Minderheit. Auch neuere Studien bestätigen dieses Bild: Sie finden keine Beweise dafür, dass die wachsende Beliebtheit von Indexfonds die Preisfindung am Markt generell schwächt.
So werden die Preise an der Börse weiterhin maßgeblich durch die Entscheidungen von Millionen aktiver Käufer:innen und Verkäufer:innen gemacht werden – nicht durch passive ETFs, die diese Entscheidungen nur abbilden. Mit diesem Wissen im Hinterkopf können wir uns nun die acht konkreten Vorwürfe genauer ansehen.
Faktencheck der acht Top-Vorwürfe
Gehen wir nun die Kritik der Skeptiker:innen nun Punkt für Punkt durch: Was wird behauptet? Was zeigen Märkte und Zahlen wirklich? Und was bedeutet das für euer Depot?
Vorwurf: ETFs verschärfen Börsen-Crashs
Die Behauptung lautet: ETFs sind wie Brandbeschleuniger in einer Krise. Wenn die Märkte anfangen zu fallen, würden massenhafte ETF-Verkäufe den Absturz dramatisch beschleunigen und zu sogenannten „Flash-Crashs“ führen, bei denen die Kurse innerhalb von Minuten ins Bodenlose stürzen.
Einer der bekanntesten Kritiker ist der US-Milliardär und Investor Carl Icahn. In viel beachteten Interviews nannte er den ETF-Markt ein „Pulverfass“ und warnte davor, dass die Beliebtheit von Indexfonds zu einer „Überhitzung“ führe. Sein Argument:
Wenn alle Anleger:innen über ETFs in dieselben wenigen großen Aktien investieren und in einer Krise alle gleichzeitig verkaufen wollen, gäbe es nicht genug Käufer, was den Markt zum Einsturz bringen würde.
Dieser Vorwurf wird oft mit dem „Flash-Crash“ vom 24. August 2015 in Verbindung gebracht. An diesem Tag fielen die US-Märkte zu Handelsbeginn extrem schnell und stark.
Richtig ist: Einige Produkte, vor allem Nischen-ETFs, waren davon überproportional betroffen und ihre Kurse fielen kurzzeitig tiefer als der Wert der enthaltenen Aktien.
Spätere Analysen, unter anderem von der US-Börsenaufsicht SEC, zeigten jedoch: Die Ursache waren nicht die ETFs selbst, sondern ein kurzzeitiger Mangel an Liquidität, was so viel heißt wie: Es gab für kurze Zeit viel mehr Verkäufer:innen als Käufer:innen.
Das eigentliche Problem 2015 waren also nicht die ETFs, sondern die Tatsache, dass die professionellen Händler (Market Maker) für die einzelnen Aktien in den ETFs nicht schnell genug faire Preise stellen konnten. Der ETF war hier also nur der Überbringer der schlechten Nachricht, nicht deren Ursache.
In den großen Krisen der jüngeren Vergangenheit, wie dem Corona-Crash 2020, hat sich das System sogar als extrem robust erwiesen: Die großen Welt-ETFs blieben jederzeit handelbar – oft besser als einige Einzelaktien, die sie enthielten.
Das bestätigt auch eine umfassende Studie der Unternehmensberatung Milliman zum Verhalten von ETFs während des Corona-Crashs. Ihr Fazit war eindeutig: Weit davon entfernt, die Krise zu verschärfen, agierten ETFs als stabilisierendes „Druckventil“ für den gesamten Markt und sorgten für konstante Handelbarkeit.
Vorwurf: ETFs verzerren die Aktienkurse
Die Behauptung lautet: ETFs funktionieren wie Autopiloten, die ohne nachzudenken Geld in die Aktien eines Index stecken. Weil alle ETFs dasselbe tun, fließt unverhältnismäßig viel Geld in die ohnehin schon größten Unternehmen wie Apple oder Microsoft, deren Kurse dadurch künstlich aufgebläht werden. Kleinere, vielleicht sogar bessere Unternehmen würden dadurch benachteiligt.
Dieser Vorwurf ist das Kernargument der bereits erwähnten Studie der Investmentfirma Sanford C. Bernstein, die passives Investieren als „schlimmer als Marxismus“ bezeichnete. Das Argument lautet zusammengefasst:
Eine Marktwirtschaft basiere auf einer effizienten Kapitalverteilung – also darauf, dass Geld dorthin fließt, wo es am produktivsten ist. Indem ETFs blind nach Größe investieren, würden sie diese zentrale Funktion außer Kraft setzen und die Preisfindung stören.
Dieses Argument ignoriert eine der stärksten Kräfte an der Börse: den Eigennutz der aktiven Anleger:innen. Diese Profis suchen ständig nach Fehlbewertungen, um daraus Profit zu schlagen.
Wenn ein ETF den Preis einer Aktie tatsächlich künstlich über einen „fairen“ Wert aufblähen würde, wäre das ein Signal für alle aktiven Manager:innen, genau diese Aktie zu verkaufen, den Gewinn einzustreichen und so den Preis wieder zu korrigieren.
Dieser Mechanismus, auch Arbitrage genannt, funktioniert wie ein Immunsystem des Marktes, das solche Verzerrungen schnell wieder ausgleicht. Solange es also genügend aktive Händler:innen gibt, die auf solche Gelegenheiten lauern – und das tun sie –, bleibt der Markt größtenteils effizient.
Aktuell ist der Marktanteil von ETFs ohnehin viel zu gering, um die Preisfindung allzu stark zu beeinträchtigen (vgl. die Zahlen oben).
Vorwurf: ETFs blähen die größten Unternehmen zu einer Aktienblase auf
Weil ETFs nach dem Prinzip „je größer, desto mehr Geld“ investieren, fließt das meiste Kapital in die ohnehin schon riesigen Konzerne wie Apple, Microsoft und Nvidia. Das wirkt Kritiker:innen zufolge wie ein Teufelskreis: Die Großen werden immer größer und ihre Dominanz wächst, während kleinere, innovative Firmen auf der Strecke bleiben. Das Ergebnis: ein gefährliches Klumpenrisiko.
Auch dieser Vorwurf wird prominent von Michael Burry („The Big Short“) geäußert:
Der Index spiegele irgendwann nicht mehr die Realität der Gesamtwirtschaft wider, sondern nur noch einen kleinen, überhitzten Ausschnitt davon.
Dieser Vorwurf verwechselt Ursache und Wirkung. Die hohe Gewichtung der Tech-Giganten ist nicht die Folge von ETFs, sondern der Grund, warum sie in den Indizes ein solch großes Gewicht haben.
Diese Unternehmen wurden über Jahre von Millionen aktiver Anleger:innen hochgekauft, weil sie extrem profitabel sind und stark wachsen. Der ETF bildet diese vom Markt vorgenommene Bewertung lediglich ab.
Richtig ist aber: Eine hohe Konzentration auf wenige Unternehmen, Länder und einen Sektor (aktuell US-Tech) ist ein tatsächliches Risiko für euer Depot. Dieses Risiko ist aber kein ETF-spezifisches Problem, sondern ein Merkmal des Gesamtmarktes. Wenn ihr in den Weltmarkt investiert, egal ob über ETFs, aktive Fonds oder Einzelaktien, seid ihr diesem Risiko ausgesetzt.
Vorwurf: Die drei größten ETF-Anbieter haben zu viel Macht
Die meisten ETFs werden von drei riesigen US-amerikanischen Firmen angeboten: BlackRock (iShares), Vanguard und State Street. Weil diese „Großen Drei“ so viele ETFs verwalten, besitzen sie im Namen ihrer Anleger:innen riesige Aktienpakete von fast allen großen Unternehmen der Welt.
Diese Konzentration an Stimmrechten, so der Vorwurf, verleiht einer Handvoll Fondsmanager:innen in den USA eine enorme, fast schon unheimliche Macht über die Weltwirtschaft. Sie könnten theoretisch die Entscheidungen bei tausenden Unternehmen beeinflussen, ohne selbst dafür im Risiko zu stehen.
Diese Kritik ist kein Nischenthema, sondern wird breit diskutiert, von renommierten Medien wie dem Wall Street Journal bis zu akademischen Studien. Einer der prominentesten Mahner ist der Harvard-Professor John Coates, der in etwa sagt:
Diese Machtkonzentration sei eine der größten Herausforderungen für die Unternehmensführung in der modernen Zeit. Die „Großen Drei“ könnten ihre eigenen Interessen (z. B. geringere Kosten für sich selbst) über die Interessen der Unternehmen oder der Gesellschaft stellen.
Es ist unbestreitbar, dass die „Großen Drei“ einen immensen Einfluss haben. Allein BlackRock, Vanguard und State Street sind zusammen die größten Aktionäre bei 88 % aller Unternehmen im S&P 500. Die Frage ist daher nicht, ob sie Macht haben, sondern wie sie damit umgehen und was das für euch als Anleger:innen bedeutet.
Als Reaktion auf die öffentliche Debatte haben die großen ETF-Anbieter begonnen, mehr Transparenz zu schaffen. So legen sie inzwischen detailliert offen, wie sie bei Hauptversammlungen abstimmen und nach welchen Prinzipien sie dabei vorgehen. Gleichzeitig entwickeln sie neue Modelle, die es ihren Kund:innen ermöglichen, selbst über die Stimmrechte der gehaltenen Aktien zu entscheiden.
Der Vorwurf der Machtkonzentration ist also berechtigt und bleibt eine der wichtigsten Debatten rund um das passive Investieren. Für euch als Privatanleger:innen ist das Risiko aber eher indirekt und betrifft die allgemeine Unternehmenspolitik, nicht die Funktion eures ETFs.
Vorwurf: ETFs sind in einer Krise nicht handelbar
Die Behauptung lautet: In einem echten Börsencrash bricht das ETF-System zusammen. Weil alle gleichzeitig verkaufen wollen, würde man seine ETF-Anteile nicht mehr loswerden oder nur zu einem katastrophal schlechten Preis. Das Geld der Anleger:innen wäre quasi über Nacht in einem wertlosen, unhandelbaren Produkt gefangen.
Dieser Vorwurf ist eine der Urängste im Zusammenhang mit ETFs und wird oft von denselben Kritiker:innen geäußert, die auch vor Flash-Crashs warnen. Sie sagen: Wenn es zu wenige Käufer:innen für die riesige Masse an ETF-Anteilen gibt, trocknet der Handel aus.
Prominente Hedgefonds-Manager wie Howard Marks haben in Memos darauf hingewiesen, dass die Liquidität von ETFs in einem echten Marktschock erst noch ihren ultimativen Test bestehen müsse. Um diesen Vorwurf zu verstehen, müssen wir kurz klären, was „Liquidität“ an der Börse überhaupt bedeutet.
Liquidität beschreibt, wie einfach ihr etwas an der Börse kaufen oder verkaufen könnt, ohne dass eure Aktion den Preis stark beeinflusst.
In normalen Zeiten ist der Markt für große Aktien oder einen Welt-ETF extrem liquide. Es gibt immer Tausende Käufer:innen und Verkäufer:innen, sodass ihr jederzeit einen fairen Preis bekommt.
In einer Krise ändert sich das Bild dramatisch: Plötzlich wollen fast alle nur noch verkaufen und kaum jemand will kaufen. Der Markt wird „illiquide“ oder „trocknet aus“.
Genau hier zeigt sich aber eine besondere Stärke von ETFs. Während der Handel mit einer einzelnen, wenig gefragten Aktie in einer Krise tatsächlich zum Erliegen kommen kann, hat ein ETF einen eingebauten Notfall-Mechanismus: den sogenannten Creation/Redemption-Prozess.
Das müsst ihr euch so vorstellen: Wenn es an der Börse zu wenige Käufer:innen für eure ETF-Anteile gibt, können große Handelshäuser (die sogenannten „Market Maker“) einspringen. Sie „kaufen“ eure ETF-Anteile und tauschen sie beim ETF-Anbieter direkt gegen den Korb mit den echten Aktien ein.

Dieser Mechanismus sorgt dafür, dass es im Hintergrund immer eine Art „Käufer letzter Instanz“ gibt und der ETF-Handel nicht einfriert.
Wie eine Studie der Unternehmensberatung Milliman zum Corona-Crash 2020 festhält, hat sich dieses System auch unter extremem Stress bewährt. Die Analyse zeigte, dass ETFs nicht nur handelbar blieben, sondern als stabilisierendes „Druckventil“ für den Markt fungierten, anstatt die Krise zu verschärfen.
Das ist zwar keine Garantie für jede zukünftige Krise, aber es ist ein starkes Indiz dafür, dass die Struktur von ETFs robuster ist, als von manchen Kritiker:innen behauptet. Der Handel wird in einem Crash durch größere Spannen vielleicht teurer, aber er bleibt möglich.
Vorwurf: Versteckte Risiken durch Swaps und Wertpapierleihe
Dieser Vorwurf ist etwas technischer und zielt auf zwei spezielle Mechanismen im Hintergrund von ETF:
- 1.
Synthetische ETFs (Swap-ETFs): Diese ETFs besitzen die Aktien eines Index nicht direkt. Stattdessen sichern sie sich die Rendite über ein Tauschgeschäft (einen „Swap“) mit einem Finanzpartner, meist einer großen Bank. Die Sorge der Kritiker:innen lautet: Wenn diese Partnerbank pleitegeht, ist das Geld der Anleger:innen verloren.
- 2.
Wertpapierleihe: Hier ist die Sorge, dass ETF-Anbieter die im Fonds enthaltenen Aktien an andere Marktteilnehmer (z.B. Hedgefonds) verleihen. Wenn der Entleiher die Aktien nicht zurückgeben kann, etwa weil er pleitegeht, entstünde dem Fonds – und damit euch – ein Verlust.
Diese Kritik war besonders nach der Finanzkrise 2008 sehr laut. In den Folgejahren veröffentlichten die wichtigsten globalen Finanzaufseher – allen voran der Finanzstabilitätsrat (FSB) in enger Zusammenarbeit mit Institutionen wie dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) – einflussreiche Berichte.
Darin wiesen sie auf genau diese strukturellen Risiken hin und forderten eine genauere Prüfung und strengere Regeln für ETFs.
Der Vorwurf beschreibt Risiken, die zwar existieren, aber durch strenge gesetzliche Regeln in Europa, genannt „UCITS-Richtlinien“, massiv entschärft wurden.
Es stimmt, dass der ETF hier ein Risiko gegenüber seinem Swap-Partner hat: das sogenannte „Kontrahentenrisiko“. Dieses Risiko ist in der EU aber gesetzlich auf maximal 10 % des Fondsvermögens begrenzt. Zudem dominieren in den wichtigsten Anlageklassen heute ohnehin die physisch replizierenden ETFs, die die Aktien tatsächlich kaufen.
Und auch die Wertpapierleihe ist stark reguliert. Wenn ein ETF Aktien verleiht, muss der Entleiher dafür Sicherheiten hinterlegen, die den Wert der geliehenen Aktien sogar übersteigen – oft 105 % oder mehr. Die Einnahmen aus der Leihe kommen zum Großteil dem Fonds zugute und können sogar eure Rendite leicht verbessern, indem sie die Kosten senken.
Die beschriebenen Risiken sind also real, werden aber durch strenge gesetzliche Vorgaben in der EU stark minimiert. Für Anleger:innen, die in einen Standard-Welt-ETF eines großen europäischen Anbieters investieren, ist das Restrisiko verschwindend gering.
Wer es ganz ausschließen will, wählt einfach einen physisch replizierenden ETF, der keine Wertpapierleihe betreibt. Diese Information findet ihr im Factsheet des ETFs oder in unserer ETF-Suche.
Vorwurf: Riskante Zocker-Produkte tarnen sich als harmlose ETFs
Die Behauptung lautet: Unter dem Deckmantel „ETF“ werden hochriskante Spekulationsprodukte verkauft, die mit sicherem, langfristigem Investieren nichts zu tun haben. Gemeint sind vor allem gehebelte ETFs, die Gewinne und Verluste vervielfachen, und Short-ETFs, die auf fallende Kurse wetten (ggf. auch mit Hebel).
Diese Warnung kommt nicht nur von Verbraucherschützern, sondern auch von den Finanzaufsichtsbehörden selbst. Sowohl die europäische Aufsichtsbehörde ESMA als auch die deutsche BaFin haben wiederholt Warnungen veröffentlicht, die sich speziell an Privatanleger:innen richten. Der Vorwurf:
Diese komplexen Produkte sind aufgrund ihrer Funktionsweise (tägliche Anpassung des Hebels) für eine Haltedauer von mehr als einem Tag ungeeignet und können zu unerwartet hohen Verlusten führen.
Der Vorwurf ist absolut berechtigt, aber er beschreibt keine „Blase“, sondern ein echtes Produktrisiko. ETFs sind nicht per se risikoarm, sondern nur so sicher wie der Markt, den sie abbilden.
Ein normaler Welt-ETF schwankt so wie der Weltmarkt. Ein „gehebelter“ Welt-ETF mit Faktor 2 hingegen steigt an einem Tag um 2 %, wenn der Markt um 1 % steigt. Er fällt aber auch um 2 %, wenn der Markt um 1 % fällt. Über lange Zeiträume führt die tägliche Neuanpassung dieses Hebels zu Ergebnissen, die selbst Profis kaum vorhersagen können.
Solche spezialisierten Produkte machen aber nur einen winzigen Bruchteil des gesamten ETF-Marktes aus. Sie haben mit den klassischen, breit gestreuten Welt-ETFs, die für passive Investor:innen relevant sind, so gut wie nichts zu tun.
Haltet euch für euer Kerninvestment an einfache, breit gestreute und ungehebelte Welt-ETFs – dann müsst ihr euch über dieses Thema keine Sorgen machen.
Vorwurf: ETFs verleiten Anleger:innen zu schlechten Entscheidungen
Die Behauptung lautet: Weil ETFs so einfach handelbar sind, verleiten sie Anleger:innen zu typischen Fehlern, die ihre Rendite am Ende ruinieren. Statt diszipliniert und langfristig nach dem Prinzip Buy-and-Hold zu investieren, würden diese ständig ihr Depot umschichten, neuen Trend-ETFs hinterherjagen oder bei den ersten Anzeichen einer Krise in Panik verkaufen.
Dieser Vorwurf stammt weniger von externen Kritiker:innen, sondern ist eine anerkannte Erkenntnis aus der Verhaltensökonomie (Behavioural Finance). Zahlreiche Studien, unter anderem die berühmte, jährlich erscheinende „DALBAR“-Studie aus den USA, belegen seit Jahrzehnten dasselbe Muster:
Die durchschnittlichen Anleger:innen erzielen eine deutlich schlechtere Rendite als der Markt selbst. Der Grund liegt fast immer im falschen Timing – also dem Versuch, zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen und zu verkaufen –, was meistens schiefgeht.
Dieser Vorwurf ist vollkommen berechtigt und eines der größten realen Risiken für euren Anlageerfolg.
Es ist aber wichtig zu verstehen: Das Problem ist nicht der ETF, sondern – wie auch diese Studie zeigt – das menschliche Verhalten. Passive Anleger:innen schaden sich selbst durch ihr Verhalten, etwa weil sie zu oft umschichten, Trends hinterherjagen oder Panikverkäufe tätigen.
Ein breit gestreuter Welt-ETF liefert euch die durchschnittliche Marktrendite. Das klingt vielleicht nicht spektakulär, aber die meisten Profis scheitern daran, dieses Ergebnis langfristig zu übertreffen.
Wenn ihr es also schafft, eure Strategie durchzuhalten und nicht auf das kurzfristige Marktgeschehen zu reagieren, habt ihr eine hohe Wahrscheinlichkeit auf eine positive Rendite über lange Zeiträume.
Historische Daten zeigen, dass bei einer Haltedauer von 15 Jahren oder mehr bei einem global gestreuten Aktienportfolio das Verlustrisiko in der Vergangenheit deutlich reduziert wurde.
Fazit: Gibt es eine ETF-Blase?
Nein: Von einer echten „ETF-Blase“ kann man nicht sprechen. ETFs treiben die Kurse nämlich nicht von selbst nach oben, sie bilden einfach nur den Markt ab. Überbewertungen und starke Schwankungen entstehen durch das Verhalten aller Marktteilnehmer:innen – ob das über ETFs, aktive Fonds oder Einzelaktien geschieht, ist dabei egal.
Die eigentlichen Risiken für euch liegen woanders: in den hohen Bewertungen einzelner Sektoren, in der Konzentration auf wenige große Unternehmen und vor allem in eurem eigenen Verhalten in einer Krise. Gegen genau diese Risiken könnt ihr euch aber sehr gut absichern: indem ihr euer Geld breit streut, euren Sparplan diszipliniert laufen lasst und Panikverkäufe vermeidet.
Ihr müsst also keine ETF-spezifische Blase fürchten – sondern nur die ganz normalen Schwankungen, die zum Investieren an der Börse dazugehören.